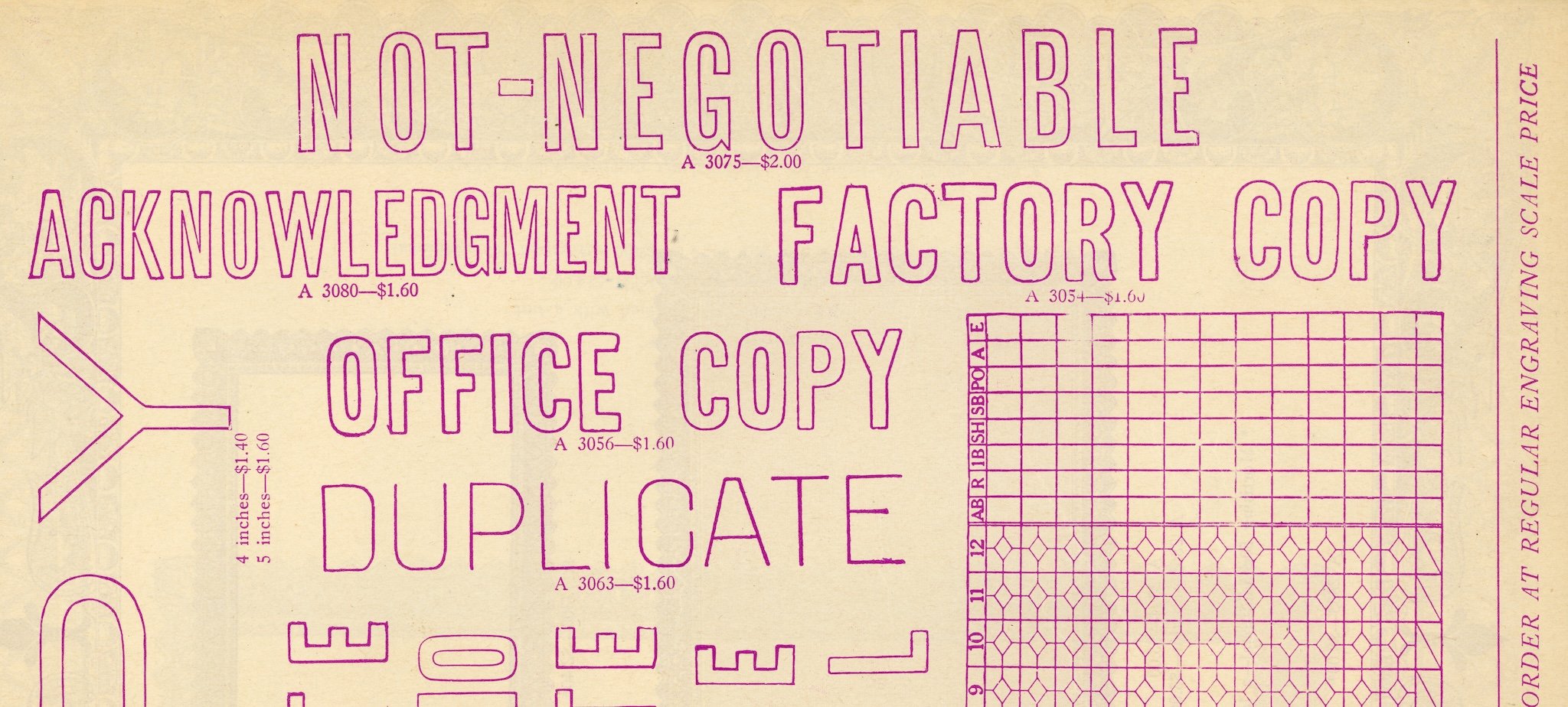
Willkommen in meiner Welt. Hier geht es um Musik, Fotografie, Bücher, Illustration und das Kino.

Die treue deiner laster
Noch vor Wochen die Nächte auf dem Zeltplatz, die mondbeleuchteten Spaziergänge zu den Waschstellen mit dem sich ausbreitenden Netz unter der Laterne, zulaufend dem festrunden Spinnenknopf in seiner Mitte wie das Straßennetz in Paris oder Barcelona und der Minzgeschmack beim Betrachten der Sternbilder über den Baumwipfeln, das feuchte Handtuch über der Schulter und das zitternde Surren des Colaautomaten…

Sieben abgepackte Herzen (schlagend)
verschmolzene Trophäen, auch die stehenden Haare deiner Politik der Wahrheit, geschneidert auf einer Endstufe im Jahr 1987, die Wasseraugen im Wind, niemals wieder, schwörtest du

Welche farbe hat die wüste nachts?
Die Stufen zur Bühne sind aus altem Holz und erinnern mich an die roten Planken der Pilar, dem kleinen Fischerboot Hemingways auf Kuba, von dem ein Farbfoto über dem Schreibtisch meiner ersten Studentenwohnung hing.

Die Jahre der erhabenen Melancholie
Die Atmosphäre faltete sich an diesem Tag zu einem dämmrigen Vakuum und ich allein glättete seine Kanten. Es hatte sich ein Raum eröffnet, in dem ich sein wollte. In diesem Augenblick begann für mich vielleicht das, was ich im Rückblick meine „Jahre der erhabenen Melancholie“ nennen könnte.

Gelbtrauernacht
Vor einem Jahr fand ich eine Ausgabe mit Braschs Gedichten in einer Berliner Buchhandlung. Ich las den großen Band in zwei Nächten und seitdem lässt mich dieser Mann nicht mehr wirklich los.

Die Hermes Baby Rooftop Bar
Einmal sitzt Thomas Kling mit seinem Wespennest auf dem Kopf an meinem Küchentisch und drückt seine Zunge in warmen Raki. Das Nest ist feucht und verharzt, er nimmt es nicht ab, seit er ins Land gekommen ist und ich kann ihn deswegen nicht ansehen.

Im Auftrag der Kosmokraten
Fünftausend Kilometer, die Kamera auf dem Sitz neben mir, das Atlan-Groschenheft auf dem Amaturenbrett und die Sterntagebücher von Lem aus den Lautsprechern. War wieder allein in diesem Sommer, zurückgeworfen auf den Klamottenhaufen meiner Talsohlenwanderei, auf die Nachwehen der Verzettelungen einiger Frühlingsmonate.

Die Smith-Corona Galaxie
Er kann mich nicht sehen, weil jemand die Äpfel aus seinen Augenhöhlen geklaut hat und ich bin erleichtert, weil ich ihm ungestört dabei zuschauen kann wie er Wespenhülsen auf meinen Küchenboden spuckt.

Zu Lebzeiten
“Selbst wenn wir wissen, dass ein nie zustande kommendes Werk schlecht sein wird, ein nie begonnenes ist noch schlechter! Ein zustande gekommenes Werk ist zumindest entstanden. Kein Meisterwerk vielleicht, aber es existiert, wenn auch kümmerlich wie die Pflanze meiner gebrechlichen Nachbarin.”

Rausgerissenes
Gerüche, das Licht, der Auslöser, die tiefen Augen, die Haut, Haarsträhnen, alles ist Plattenhören im Pastisrausch, Knistern und Wellen auf den Innenseiten meiner Augenlider.

AGFAMATIC TEEN 70' UND DAS GEHEIMNIS DES OOZE
Meine erste Kamera schenkte mein Vater mir im Sommer 1991. Fortan trug ich seine ausrangierte Agfamatic Pocket überall herum, knipste, was mir so begegnete, natürlich ohne dass ich einen Film eingelegt hatte - das „Ritsch-Ratsch- Klick“ der Kamera war mir Belohnung genug auf meinen ausgedehnten Ausflügen als Reportagefotograf.

Der schüchterne Kartograph
Mit acht Jahren begann meine Phase als schüchterner Kartograph. Wenn man oft genug die gleiche Abzweigung nimmt, landet man wieder beim Ausgangspunkt. Das hatte ich von meinem Onkel gelernt.

Analphabet und glücklicher Mensch
Niemand wartet auf dich. In tiefer Nacht sind es sogar noch weniger. Ich musste eine Reihe meines Bücherregals leerräumen, um diese Zeilen hier im Stehen tippen zu können. Mein Rücken zerfällt langsam auf meinem Stuhl. Zu meinen Füßen liegen unzählige bedruckte Papiere.

The Days run away like wild Horse over the Hills
Ich werde in zwei Wochen 37. Meine Biografie bis hier hin, alles andere als ein gerader Weg mit fest definierten Zielen. Viele Kurswechsel, Abbrüche, Neustarts prägten die Jahre nach meinem Abitur, in denen es mir nie wirklich schlecht ging.

Notizbuch (2)
Seit der Quarantäne wilde, teils psychedelische Träume in Realzeit. Mehrmals in dieser Woche direkt nach dem Wachwerden Bilder aufgeschrieben, Farben, Nöte. Die Tage entgleiten einem, zwischen Buchseiten, Waldläufen und Telefonaten.

Der Sommer endet.
Überspannt. In der vergangenen Woche keine Nacht ohne Traum. Das Gefühl, mitten im Tiefschlaf geweckt zu werden, obwohl man verschlafen hat. Innerlich aber Ruhe, nach dem Entschluss, das Jahr in Teilen verloren zu geben.

We are fucking here
Ich bin auf Maui, Kahului Airport. Ein Sonntagmorgen. Pualani, das Hula-Mädchen mit dem einladenden Lächeln auf dem Purpur-Heck der Hawaiian Airlines Maschinen, taucht wieder und wieder in die Wolken über der Startbahn ein. Der Food Court ist der einzige klimatisierte Raum des Flughafens. Den Tisch am Fenster habe ich mir mit drei 7-Dollar-Bierdosen und einem Stück Pizza für 17 Dollar erkauft.

Salao
Auf dem Weg nach Hause hörte ich gestern das Hörbuch von Hemingways „Der alte Mann und das Meer“. Es ist fast 15 Jahre her, seit ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, danach dann noch ein paar Mal in meinen Zwanzigern und gestern dann wieder.

Sieben in der Nacht getippte Seiten aus dem Jahr 2009
Mehr und mehr fühlst du dich wieder Mann in dieser Geschichte von Jorge Luis Borges, Funes, der nichts vergessen kann, der alles und jeden in sich aufnimmt ohne je über etwas hinwegzusehen. Dann suchst du ihn, den Jungen, mit seinem Lachen, der dir nun die Absolution der Gleichgültigkeit verweigert. Und sich versteckt. Und dich zurücklässt. In deiner ewigen Nacht.

Rocket Man
Ein Landstreicher trifft eines Nachts einen Gleichgesinnten und teilt sich mit ihm Essen und Feuer. Der Fremde stellt sich als ehemaliger Teil einer Freak Show heraus. Sein ganzer Körper ist tättowiert. Die Tattoos sind exakt getrennt in einzelne Stücke, die in der Nacht zu Leben beginnen. Die Geschichten, die von den Tattoos erzählt werden, sind die Kurzgeschichten in dem Band.

