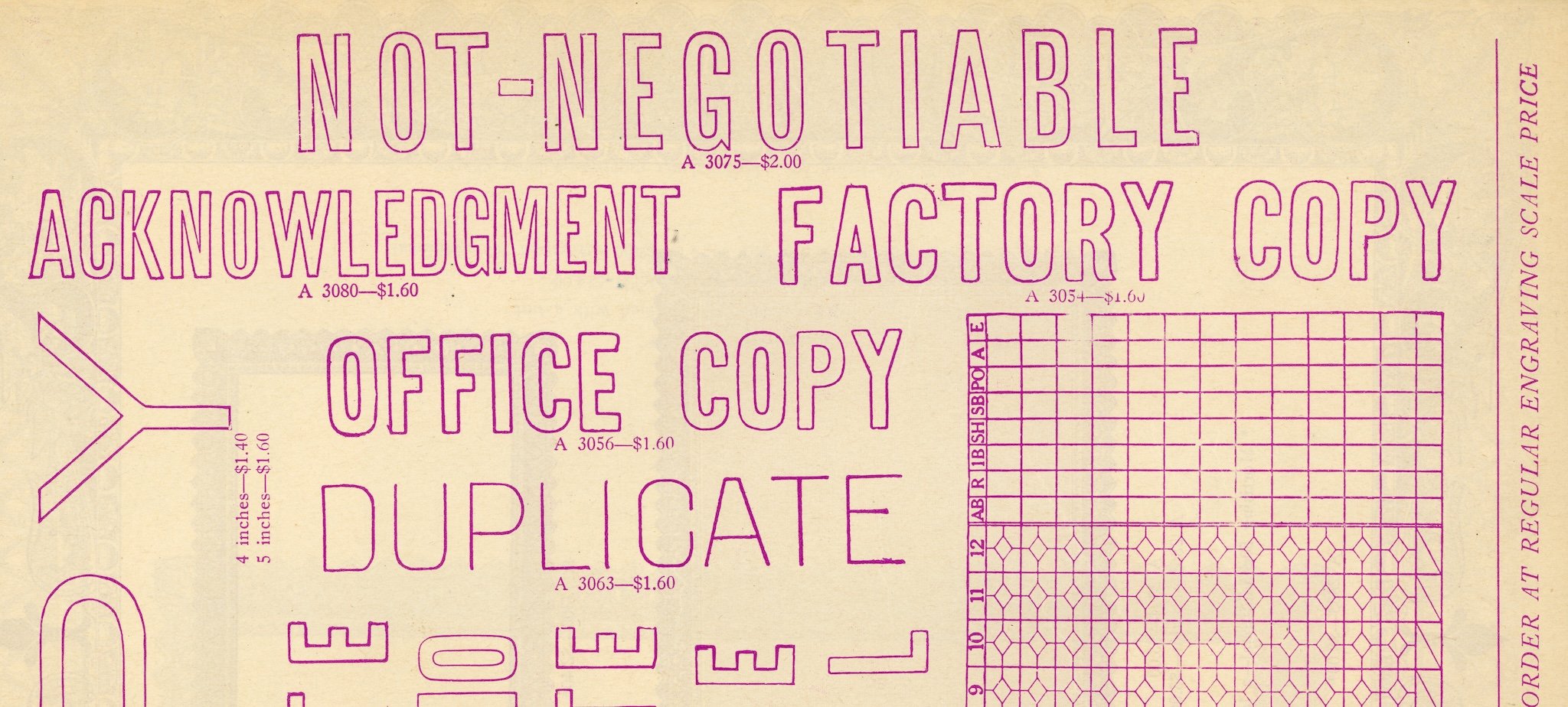
Willkommen in meiner Welt. Hier geht es um Musik, Fotografie, Bücher, Illustration und das Kino.

Ramshackle Day Parade
Ein Tag in Bochum und die Ewigkeit nach Joe Strummer.

UBU ROI
Das Antiquariat “Ubu” von Wolfgang Jöst in Bochum.

Ein gutes Café an der Place St. Michel
Einige Postkarten aus Paris.

Lost Ghosts, Pynchon Nights & Good Tomatoes
A visual diary from a week in August.

Ein Bewohner von Mlejnas und Tlön
Trank Bier und las in Borges Geschichte der Nacht, „der Schädelknochen, das geheime Herz“, und jetzt, ein paar Stunden später, die roten Tintenflecken wie Blut auf den weißen Bettlaken.

The Flailing Notebook
Vor ein paar Tagen kaufte ich einen Füllfederhalter und dieses Notizbuch. Es gab keinen Grund. Vielleicht kann ich mich mit dieser Feder wieder am Leben festkrallen. Und meine Hände mit grüner Tinte beflecken.

Bildschirm
Doch es reicht nur für geschundene Zeilen. Bevor sie mich abholen, die küssenden Fährleute in ihren Mänteln. Sie warten. Das Ende einer Erzählung innerhalb eines Traumes von gelbgrünem Blech. Das Unerkannte entspricht mir ja im Grunde. Will jetzt schwimmen. Im Salz. Im Sand. An der Seite eines verstreuten Kapitäns. Die Finger werden taub. Und irgendwie traurig. Exegese der Verse eines Schirmes aus Bildern.

STAMBOUL BLUES
Zwei melancholische Spaziergänge durch Istanbul

Die treue deiner laster
Noch vor Wochen die Nächte auf dem Zeltplatz, die mondbeleuchteten Spaziergänge zu den Waschstellen mit dem sich ausbreitenden Netz unter der Laterne, zulaufend dem festrunden Spinnenknopf in seiner Mitte wie das Straßennetz in Paris oder Barcelona und der Minzgeschmack beim Betrachten der Sternbilder über den Baumwipfeln, das feuchte Handtuch über der Schulter und das zitternde Surren des Colaautomaten…

Welche farbe hat die wüste nachts?
Die Stufen zur Bühne sind aus altem Holz und erinnern mich an die roten Planken der Pilar, dem kleinen Fischerboot Hemingways auf Kuba, von dem ein Farbfoto über dem Schreibtisch meiner ersten Studentenwohnung hing.

Die Jahre der erhabenen Melancholie
Die Atmosphäre faltete sich an diesem Tag zu einem dämmrigen Vakuum und ich allein glättete seine Kanten. Es hatte sich ein Raum eröffnet, in dem ich sein wollte. In diesem Augenblick begann für mich vielleicht das, was ich im Rückblick meine „Jahre der erhabenen Melancholie“ nennen könnte.

Das Theater der Häute
Endlose Nahaufnahme. Ich habe die Welt verlassen, begehe Gedichte. Das Romanhafte ist lachhaft unglaubwürdig.

Gelbtrauernacht
Vor einem Jahr fand ich eine Ausgabe mit Braschs Gedichten in einer Berliner Buchhandlung. Ich las den großen Band in zwei Nächten und seitdem lässt mich dieser Mann nicht mehr wirklich los.

Die Hermes Baby Rooftop Bar
Einmal sitzt Thomas Kling mit seinem Wespennest auf dem Kopf an meinem Küchentisch und drückt seine Zunge in warmen Raki. Das Nest ist feucht und verharzt, er nimmt es nicht ab, seit er ins Land gekommen ist und ich kann ihn deswegen nicht ansehen.

Im Auftrag der Kosmokraten
Fünftausend Kilometer, die Kamera auf dem Sitz neben mir, das Atlan-Groschenheft auf dem Amaturenbrett und die Sterntagebücher von Lem aus den Lautsprechern. War wieder allein in diesem Sommer, zurückgeworfen auf den Klamottenhaufen meiner Talsohlenwanderei, auf die Nachwehen der Verzettelungen einiger Frühlingsmonate.

Rausgerissenes
Gerüche, das Licht, der Auslöser, die tiefen Augen, die Haut, Haarsträhnen, alles ist Plattenhören im Pastisrausch, Knistern und Wellen auf den Innenseiten meiner Augenlider.

Analphabet und glücklicher Mensch
Niemand wartet auf dich. In tiefer Nacht sind es sogar noch weniger. Ich musste eine Reihe meines Bücherregals leerräumen, um diese Zeilen hier im Stehen tippen zu können. Mein Rücken zerfällt langsam auf meinem Stuhl. Zu meinen Füßen liegen unzählige bedruckte Papiere.

Notizbuch (2)
Seit der Quarantäne wilde, teils psychedelische Träume in Realzeit. Mehrmals in dieser Woche direkt nach dem Wachwerden Bilder aufgeschrieben, Farben, Nöte. Die Tage entgleiten einem, zwischen Buchseiten, Waldläufen und Telefonaten.

Der Sommer endet.
Überspannt. In der vergangenen Woche keine Nacht ohne Traum. Das Gefühl, mitten im Tiefschlaf geweckt zu werden, obwohl man verschlafen hat. Innerlich aber Ruhe, nach dem Entschluss, das Jahr in Teilen verloren zu geben.

